Ten Years After - Ssssh (1969 / 2025)
Als der Blues-Rock flügge wurde.
In den mittleren und späten 1960er Jahren gab es in Großbritannien einen Boom elektrisch ausgerichteter Formationen, die mehr oder weniger dem Blues-Rock zugeneigt waren. Dazu gehörten unter anderem John Mayalls Bluesbreakers, und The Yardbirds. Dann noch Peter Greens Fleetwood Mac, Cream sowie Ten Years After, die Band des Meister-Gitarristen Alvin Lee, welche 1967 in Nottingham, England, gegründet wurde.
Ten Years After gingen aus der Band Ivan Jay & The Jaycats hervor, die sich seltsamerweise 1966 in Jay & The Jaybirds und danach in Ivan Jay & The Jaymen umbenannte. Ten Years After veröffentlichten ihr schleunig zusammengestelltes Debüt-Album bereits 1967, im Jahr ihrer Gründung, in der Besetzung: Alvin Lee (Gesang, Gitarre), Leo Lyons (Bass), Ric Lee (nicht verwandt mit Alvin Lee) (Schlagzeug) und Chick Churchill (Orgel). Ein Jahr später kam das Live-Album „Undead“ heraus und 1969 folgte der internationale Durchbruch mit dem Auftritt beim Woodstock-Festival. In demselben Jahr produzierten die Musiker zwei Platten: „Stonedhenge“ erschien im Februar und „Ssssh“ wurde im September, also etwa einen Monat nach dem Woodstock-Triumph herausgebracht.
Am 31. Oktober 2025 erscheint nun eine
3-CD-Deluxe-Ausgabe von „Ssssh“, die das Originalalbum, einen aktuellen Stereo-Mix davon
und sechs bisher unveröffentlichte Live-Stücke von 1969 aus Helsinki enthält.
Das Doppel-Vinyl beinhaltet nur die überarbeiteten Stereo-Studioaufnahmen und
das Konzert.
Es ist einigermaßen erstaunlich, wie gut „Ssssh“ den Zahn der Zeit überstanden hat. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sich keine damals durchaus üblichen ausufernden Improvisationen, Solo-Eskapaden oder Jam-Sessions darauf finden lassen. Mit etwas über sieben Minuten ist der adaptierte Blues-Klassiker „Good Morning Little School Girl“, den erstmals Sonny Boy Williamson 1937 aufnahm, der längste Track der Platte, und das, was die Musiker hier an instrumentalen Freiräumen nutzen, wirkt immer noch knackig, schweißtreibend und prickelnd. Ein weiterer Pluspunkt sind die konzentrierten Einzelleistungen der Beteiligten, die zu einer homogenen Einheit zusammenwachsen: Der Bass ist trocken und kräftig und übernimmt auch Führungsrollen, die Drums wirbeln gezielt den Hintergrund durcheinander und die Orgel grollt, rauscht oder dröhnt tatkräftig, um den Sound effektiv zu verdichten. Das Gitarrenspiel ist virtuos, mal gefühlvoll-eindringlich, mal temporeich-schweißtreibend, auf jeden Fall aber vielsagend und der Gesang tönt dazu rebellisch und ausdrucksstark.
Es geht los mit „Bad Scene“, das als Einstiegs-Gimmick ein Quietschen hervorbringt, welches an jaulende Katzen erinnert. Danach startet eine Geschwindigkeitsoffensive, die von einem hämmernden Piano angeführt wird. In dieses akustische Rennen schaltet sich die E-Gitarre ein, bremst das Rennen plötzlich durch Heavy-Metal-Akkorde aus und lässt sich dann wieder auf das rasante Tempo ein. Dieses Spiel, bestehend aus glühender Hochgeschwindigkeit und metallischem Bremsen, wiederholt sich danach ständig, was den Titel länger erscheinen lässt, als er mit seinen dreieinhalb Minuten tatsächlich ist. Das Piano-Stakkato lässt Erinnerungen an Jerry Lee Lewis oder an manche The Stooges-Tracks aufflackern. Die hitzigen Rock & Roll- und Prä-Punk-Tiraden verfehlen nicht ihre stimulierende Wirkung, denn im Verlauf werden kontrastreich historische Rock & Roll-Klänge und progressive Gitarrenexkursionen gegenübergestellt.
Mit „Two Time Mama“ folgt ein waschechter Country- und Folk-Blues mit prägender Slide-Gitarre, der recht munter unterwegs ist, weshalb sich die diskret vorhandene Melancholie nur sanft um die Noten legt und nicht lähmend daherkommt.
Der muskulöse Boogie-Blues von „Stoned Woman“ könnte gleichfalls als früher Glam-Rock durchgehen, so frech, vorwärtstreibend und herrlich respektlos ist er.
Ein elektrisches Peitschen und Zischen, das von beschädigten Stromleitungen verursacht sein könnte, leitet das schon erwähnte Kernstück „Good Morning Little School Girl“ ein. Der stoische Blues-Rocker weiß durch druckvolle Beharrlichkeit, eine gesunde Portion Aggressivität und ein markantes Rock-Riff zu überzeugen. Das E-Gitarren-Solo wird zunächst vom flinken Bass von Leo Lyons flankiert, bevor das virtuos-fantasiereiche und mächtige Schlagzeug einsetzt. Dieses Konstrukt nähert sich einer energisch-aufdringlichen Beharrlichkeit an, welche bei Jazz-Improvisationen vorkommt, und wird hier als Stilmittel spannungsgeladen und genussvoll ausgereizt.
Das sich tempomäßig allmählich steigernde „If You Should Love Me“ ist den Beatles näher als den Rolling Stones. Es tendiert eher zum Power-Pop als zum Blues-Rock und bringt dadurch einen unerwarteten, frischen, optimistischen Ausdruck in das Album ein.
Mit „I Don`t Know That You Don`t Know My Name“ zieht englischer Folk-Rock in das Album ein. Das Stück wurde jugendlich arrangiert, eine traditionelle Betrachtungsweise gerät dadurch ins Hintertreffen, bleibt aber spürbar. Das ist ein Rezept gegen drögen Folk aus der Mottenkiste. Dem Lied wird durch etwas Hall ein räumlicher Klang verabreicht, der sich zwischen akustischer Gitarre, Piano und Trommeln ansiedelt.
„The Stomp“ ist ein saftiger Boogie im stampfend-groovenden Stil eines John Lee Hooker. Diese Form des Blues lebte im schwülen Swamp-Rock von Tony Joe White und bei George Thorogood & The Destroyers weiter, der in den späten 1970er Jahren mit solcher Musik populär wurde. Eine hastig und kurz angeschlagene Orgel zerschneidet für "The Stomp" die Luft und die Rhythmusfraktion hält den Song stoisch-unbeirrt zusammen. Alvin Lee ordnet sich diesem hypnotischen Treiben unter, sticht absichtlich solistisch nicht heraus und unterstützt auf diese Weise die monotone Magie des Liedes.
Die Phrase „I Woke Up This Morning“ findet man in vielen alten Blues-Songs wieder. Hier handelt es sich aber um eine Alvin Lee-Komposition eines elektrischen Slow-Blues, dem man eine Schippe voll Dreck zwischen die Noten geschmissen hat. Gut so! Der Track zapft zwar gängige Blues-Schemata an (“I Woke Up This Morning, my Baby was gone...), klingt dennoch überhaupt nicht altbacken, sondern druck- und kraftvoll.
„Ssssh“ kann man auch nach 26 Jahren noch gut ohne vorgeschobene Nostalgie-Anwandlungen anhören und sich daran erfreuen. Das Programm ist abwechslungsreich, die Darbietung zeigt handwerklich hervorragende Resultate und die Songs haben Substanz und ufern nicht in puren Technikdemonstrationen aus. Hinzu kommt das differenzierte, abwechslungsreiche Material, bei dem neben dem Blues auch Einflüsse aus klassischem Rock & Roll, Progressive- und Psychedelic-Rock, sowie Beatles-Pop, Folk und Soul verarbeitet werden.
Der neue 2025er-Mix klingt lauter und robuster als die 1969er-Fassung, ohne steril zu wirken. Der Live-Aufnahme hört man das Alter an, sie schwächelt in der Dynamik, die Gesangsspur schwankt zwischen laut und leise, sie ist jedoch weitaus besser als viele Bootlegs aus der Zeit. Für Hardcore-Fans kann sie eine interessante Bereicherung sein, zwingend notwendig ist sie allerdings nicht. Denn es gibt ja schon die guten anderen offiziellen Konzertmitschnitte: „Undead“ aus 1968 und „Recorded Live“ von 1973. Im Gegensatz zu "Ssssh" findet man beim Helsinki-Konzert der Box längere Solo-Eskapaden, die die technischen Fähigkeiten der Musiker unterstreichen, aber dem Flow der Songs nicht guttun: Für das über 9 Minuten lange, auf Rock & Roll-Wurzeln aufgebaute "I May Be Wrong But I Won`t Be Wrong Always" erhält jeder Musiker die Möglichkeit, sich auf seinem Instrument auszuzeichnen, das über 10-minütige "The Hobbit" ist fast ein reines Drum-Solo und das fast 11-minütige, unter "No Titel" gelistete Stück bietet wilde E-Gitarren-Drum- und Orgel-Drum-Improvisationen. Der Höhepunkt des Konzertmitschnittes ist das über 18 Minuten lange "I Can`t Keep From Crying Sometimes", bei dem sich die Spielfreude der Band gut mit dem actiongeladenen Ablauf verträgt, weil den Beteiligten ständig neue Ideen einfallen. Dazu zählen unter anderem Verbeugungen vor The Doors ("When The Music`s Over") oder geliehene Riffs von "Sunshine Of Your Love" von Cream.
"Ssssh" ist eine willkommene Wiederveröffentlichung. Das Album stellt eine Schnittstelle zwischen Traditionsbewusstsein und der Epoche eines musikalischen Aufbruchs dar. Es ist der Zeitraum, in dem der Blues-Rock seine Identität ausweitete, sich weiter von strengen Erwartungen löste und flügge wurde. Ten Years After war eine Formation, die aus talentierten, gleichgesinnten, leidenschaftlich agierenden Heißsporen bestand, die für ihre Ideen brannten. Aber schon 1975 kam es zum Zerwürfnis, das wahrscheinlich aufgrund des permanenten Stresses und vertraglicher Ungereimtheiten hinsichtlich des Mitspracherechts und der Vergütung entstand. Nach wenigen Reunion-Versuchen reformierte sich die Gruppe 2003 ohne Alvin Lee, was natürlich lächerlich war.
Alvin Lee machte nach der Trennung unter eigenem Namen weiter, arbeitete unter anderem mit Mick Taylor (The Rolling Stones) und George Harrison (The Beatles) zusammen und veröffentlichte unter anderem 1973 das schöne Album "On The Road To Freedom" gemeinsam mit dem Gospel-Sänger Mylon LeFevre. Tragischerweise starb Lee schon 2013 mit 68 Jahren an den Folgen einer Routineoperation. Er wird aber für seine innovative Leistung bei der Weiterentwicklung des Blues-Rocks und für seine rasante Grifftechnik in Erinnerung bleiben, die sogar bei Jimi Hendrix für Hochachtung sorgte.
Der Bandname fiel dem Bassisten Leo Lyons ein, als er eine Anzeige für das Buch "Suez - Ten Years After" sah, in dem es darum ging, dass Großbritannien, Frankreich und Israel im Jahr 1956 versuchten, von Ägypten die Kontrolle über den Suezkanal zu übernehmen. Der Titel "Ssssh" ist eine Lautmalerei, die im Deutschen so viel wie "Pssst" bedeutet, also für "leise sein" steht. Leo Lyons und Alvin Lee warfen sich nämlich aus Spaß oft vor, mit ihrem Instrument zu laut zu sein. Es ist aber indirekt auch eine Aufforderung oder Einladung, genau zuzuhören. Und das lohnt sich immer noch bei diesem interessanten Werk. Und zwar nicht nur für Blues-Liebhaber!





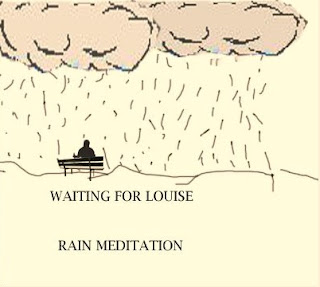
Kommentare
Kommentar veröffentlichen