Woodland - Bad Days In Disguise (2019)
Unerschöpfliches Trondheim: Woodland erweitern das Umfeld von Motorpsycho mit "Bad Days In Disguise".
Trondheim in Norwegen ist die Heimat von Motorpsycho und die Stadt scheint - was deren Einfluss angeht - fest in ihrer Hand zu sein. Die Band hat stilübergreifend ihre Spuren hinterlassen, ihre Einflüsse geltend gemacht oder Ableger gegründet. Egal, ob sie jetzt Spidergawd, Moving Oos, Orango, Wizrd, Draken oder Sugarfoot heißen, der heiße Atem der Überväter ist überall zu spüren. So auch bei Woodland. Das Quintett hat nämlich Hallvard Gaardløs in ihren Reihen, der auch Bassist bei Spidergawd und Orango ist. Die Combo scheint grade der Garage, dem Quell der Entstehung brachialer, explosiver, mächtiger Rock-Musik entsprungen zu sein. Ihre Rhythmen peitschen hungrig, die Gitarre sucht zwischen Blues, Psychedelic-, Hard- und Heavy-Rock nach Anerkennung, der Bass baut mächtig am Gerüst des Gebäudes, die Keyboards verzieren stilübergreifend und der Sänger empfiehlt sich als selbstbewusster Allrounder.
Heftiges Schlagzeugbeckengeschepper, dumpfe Basstrommeln und eine jaulende Gitarre leiten „Something (You Wanna Get)“, den Opener von „Bad Days In Disguise“, alarmierend ein. Sänger Gisle Solbu lässt sich von dem Spektakel nicht ablenken und führt den Song in melodische Bahnen, ohne den Druck dadurch zu verringern. Das Stück riecht nach Aufbegehren und Freiheit und sollte in einem Cabrio mit offenem Verdeck in maximaler Lautstärke gehört werden.
„Not A Chance“ ist ein unruhiger Speed-Boogie mit pumpendem Bass und treibenden Drums, der im Mittelteil zur Raison gebracht wird und dann durch ein kurzes, egozentrisches Gitarren-Solo auffällt. Insgesamt fehlt dem Track aber eine ordnende Struktur, wodurch er zwischendurch an Durchschlagskraft verliert.
„Oh My God“ bleibt trotz des weitgehend stoisch-kräftigen Rhythmusgeflechts mystisch-geheimnisvoll sowie undurchsichtig und klingt alles in Allem wie ein verschollenes Lied von „Led Zeppelin III“. Die Reifeprüfung gelingt der Formation mit der obligatorischen Ballade „Kisses“. Alle schwachen, unsicheren Kapellen knicken bei solch einer Herausforderung ein und werden süßlich-kitschig. Nicht so Woodland. Sie bewahren sich bei der Interpretation ein dunkles Geheimnis und agieren empathisch, aber emotional kontrolliert.
Das gehetzte „Shout It“ erzeugt danach den Eindruck, dass es zwischen Glam-, Punk- und Space-Rock vermitteln möchte.
Auch „Wonder Wheel“ würde prächtig ins Led Zeppelin-Repertoire passen. Der Blues-Rock lässt sich treiben, bäumt sich auf und Gisle Solbu produziert als Leckerei positive Robert Plant-Vibes, ohne den Sänger allerdings zu imitieren. Nur ein Jimmy Page-artiges Gitarren-Solo fehlt, um die Erinnerung vollständig erscheinen zu lassen. Diesen Part übernehmen die ausgedehnten Jazz-Keyboard-Parts von Hallvar Haugdal.
„Gimme Some“ ist ein dreckiger, giftiger Garagen-Rocker, der wegen seiner Widerspenstigkeit auch von Jack White (ex-The White Stripes) oder Dan Auerbach (The Black Keys) stammen könnte. Die Gitarre scheint hier aus dem Jenseits von Jimi Hendrix ferngesteuert zu werden.
Das gnädig gestimmte „Burning Sun“ schnuppert am Funk, ohne dessen Protzigkeit anzunehmen, sondern bleibt cool, sumpfig und überlegen. Der Song ist letztlich ein gewagter Hybrid aus Pop-Geschmeidigkeit, Soul-Groove und Rock-Klarheit geworden.
Der Bass dröhnt unerbittlich bei „All Those Times“ und die Grabesstimme lässt die frühen Black Sabbath auferstehen. Die E-Gitarre von Espen Kalstad, das Keyboard von Hallvar Haugdal und die Background-Vocals fräsen sich gelegentlich durch den intensiven Krach. Das Schlagzeug von Espen Berge erschafft sich parallel dazu erregende Freiräume. Später gibt es noch ein Gitarren-Solo, das so klingt, als sei es von der Allman Brothers Band ausgeliehen worden. Aus dieser Mischung ergibt sich ein brodelnder High-Energy-Noise-Rock, der mit Power-Pop-Viren geimpft wurde.
Trondheims Bands lassen sich in der Regel nicht von Stil-Klischees vereinnahmen. Auch nicht Woodland. Es blitzen höchstens mal Referenzen an Vorbilder auf oder diese werden parodistisch verdreht. Individualismus spielt eine große Rolle, was die Formationen aus dieser Gegend oft wohltuend von den ehrerbietenden Classic-Rock-Verwaltern unterscheidet. Diese Tendenz ist genauso bei Woodland zu spüren und auch deshalb liefern sie mit „Bad Days In Disguise“ nach „Go Nowhere“ von 2017 wieder eine überdurchschnittliche Leistung ab.
Erstveröffentlichung dieser Rezension: Woodland - Bad Days In Disguise



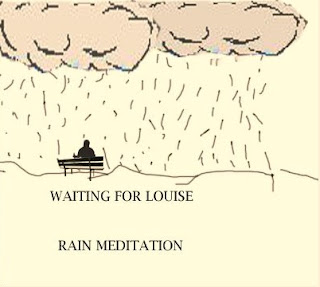
Kommentare
Kommentar veröffentlichen