Slow Club - One Day All Of This Won´t Matter Any More (2016)
Zehn Jahre nach Gründung des Slow Club sucht das Gründungsduo nach einem veränderten Betätigungsfeld, ohne sich dabei grundsätzlich untreu zu werden.
Rebecca Taylor und Charles Watson aus Sheffield suchten nach einer klaren Linie. Deshalb haben sie sich nach zehn Jahren im Geschäft und drei Alben als Slow Club, bei denen sie sich an Pop und Indie-Folk orientierten, neue Ziele gesteckt. Der Produzent Matthew E. White, der für seine außergewöhnlichen, vielschichtigen Gospel-Pop-Arrangements bei seinen eigenen Arbeiten bekannt ist, sollte helfen, neue Horizonte zu öffnen. White stellte seine Band zur Verfügung, sorgte so tendenziell für einen geschmeidigen, dezenten Southern-Soul-Groove und stellte als Betreuer die Stärken des Duos heraus.

Herausgekommen ist dabei eine Scheibe, die bei einigen Songs tatsächlich eine Fokussierung auf eine schwebende Leichtigkeit hervorbringt. Hier feiert das Duo die unverkrampfte Klarheit des Pop: Geschickt wird „Silver Morning“ zwischen entspanntem Pop und intimer Ballade variiert, ohne dass der Flow gestört wird. „Sweetest Grape On The Vine“ verzückt durch leicht versetzt angelegten Duett-Gesang, der verführerisch zu einem psychedelischen Dream-Pop einlädt. „Rebecca Casanova“ lässt den Pop-Verstand von Fleetwood Mac auferstehen und erinnert dadurch an deren „Rumours“-Album. „Tattoo Of The King“ kennt die Geheimnisse, wie ein cleverer Pop-Song ablaufen sollte: Tempo- und Dynamik-Wechsel werden genauso berücksichtigt wie eine schüchtern bis verträumt angelegte, verschachtelte Melodie. Als Referenz fällt die Edel-Pop-Kapelle Squeeze aus den 1980er Jahren ein. „Let The Blade Do The Work“ ist ein Lied, das unaufdringlich, leicht und karibisch perlend sowie behutsam abläuft.
Als Gegenpol dazu gibt es auch nachdenkliche, dunkler gefärbte Tracks, deren Seriosität zum konzentrierten Zuhören auffordern: „Where The Light Gets Lost“ mutet wie eine depressive Americana-Variante mit Easy Listening-Einschlag an. Die Tristesse von „Ancient Rolling Sea“ bekommt durch einen wuchtigen Bass Aufwind und die Steel-Gitarre vermittelt dazu noch Weite und Freiheit. So macht Nachdenklichkeit Spaß. Rebecca Taylor verleiht dem schnell getakteten „In Waves“ etwas Ernsthaftigkeit und Selbstbewusstsein. Die Pedal-Steel weint dazu außer Reichweite dicke Tränen.
Ein munteres Gitarren-Solo übertüncht dann am Schluss den traurigen Beigeschmack. Dann gibt es noch einen ungelisteten Hidden-Track, der durch flächige Orgel-Klänge, mystischen Gesang und dezent rollende Trommeln feierlich rüberkommt.
Wird es zu theatralisch, verkrampft zumindest Rebecca und wirkt überambitioniert: Glitzernde E- und Steel-Gitarren-Kaskaden begleiten „Come On Poet“ wohltönend, aber der Gesang klingt über längere Zeit gepresst und klingt dadurch unterdrückt statt frei fließend. Nach etwa drei Minuten befreit sich die Sängerin stimmlich und verschafft sich überschwänglich Luft. Diese Art der pathetischen Darstellung lenkt vom wahren Talent der Musiker ab und wirkt lähmend. Bei „Give Me Some Peace“ fleht Rebecca gospelhaft, erreicht aber nicht die nötige emotionale Tiefe, um zu überzeugen, und „Champion“ fehlt es an einer überzeugenden Melodie. Der Gesang hört sich hier gekünstelt wie bei Musicals an. Bei der Ballade „The Jinx“ wird die Instrumentierung im Hintergrund allmählich von einer Nebensache zu einer Macht entwickelt. Die Melodie setzt sich jedoch nicht fest und der Bombast verhallt, ohne Wirkung zu hinterlassen.
Die Produzentenwahl war ein kluger Schachzug, um zu versuchen, eingefahrene Wege zu verlassen. Das ist dem Slow Club teilweise gelungen, muss aber noch geschärft und fokussiert werden. Die geschmeidige Lässigkeit des Southern Soul und der Pop-Schwung stehen ihnen gut. Die Theatralik und übertriebene Ernsthaftigkeit bremst allerdings den Hörspaß. Da ist in Summe sicher noch mehr drin.


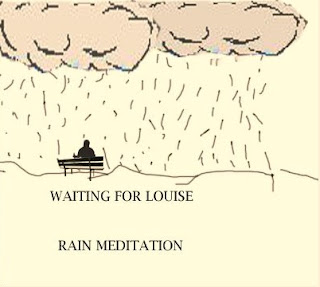
Kommentare
Kommentar veröffentlichen